
Wie wir gemeinsam gute Entscheidungen für die Zukunft treffen können
Was essen wir zu Mittag? Fahren wir im Urlaub ans Meer? Sollen wir heiraten? Investieren wir in dieses Projekt? Wollen wir mit diesem Partner kooperieren? Unser Leben besteht aus tausenden Entscheidungen. Täglich. Manche dieser Entscheidungen treffen wir allein, viele davon in Gruppen. Mit dem Partner oder der Partnerin, mit der Familie, mit Freunden, in hierarchisch geführten Organisationen, Arbeitsgruppen, Ausschüssen, Parlamenten oder kollaborativen Teams. Von der Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen und mit deren Konsequenzen zu leben, hängt unsere Zufriedenheit ab. Individuell, in der Gruppe, in der Gesellschaft, im Privatleben und im Job.
Doch wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Welche Informationen benötigen wir dazu und was ist überflüssig? Wie unterscheiden sich Entscheidungen, die wir im stillen Kämmerlein treffen von jenen, die ein Gespräch oder Streit in einer Gruppe benötigen? Und wie schaffen wir es, uns nicht mehr immer für die gleichen Nudeln, den Urlaub ans Meer und den gleichen Partner zu entscheiden und den herkömmlichen Optionen neue Alternativen hinzuzufügen, die wir noch gar nicht kennen?
Grundsätzlich vereinen wir zwei verschiedene Denksysteme: ein rationales und ein emotionales. Das rationale sammelt Informationen, selektiert, überlegt und entscheidet. Emotionales Entscheiden setzt auf Gefühle und auf Intuition. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio fand heraus, dass unsere Entscheidungen immer, wenngleich in unterschiedlichen Ausprägungen, von unserem emotionalen Apparat und unseren Erfahrungen beeinflusst sind. Intuition spielt also eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung. Das macht es für uns einerseits einfacher, weil wir nicht immer Millionen Information sammeln müssen, es hat aber andererseits einen Haken: Wir wählen immer nur unter den Optionen aus, die wir bereits kennen. Und eigentlich wäre es ja schön, sich aus dieser Pfadabhängigkeit zu befreien.
Die meisten Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen, registrieren wir gar nicht. Das macht unser Gehirn für uns, wir arbeiten auf Autopilot. Dieser beruft sich auf unseren Schatz aus guten und schlechten Erfahrungen. Was aber ist mit jenen großen Entscheidungen, die uns den Schlaf rauben, uns Pro- und Contra-Listen schreiben lassen und die großen Besprechungsbedarf mit Freunden, Vertrauten oder Arbeitskollegen haben?
Daten, Information und Entscheidung
Normativ gesprochen blenden wir für diese großen Entscheidungen unser Bauchgefühl aus, zumindest spielen wir uns oft selbst vor, dass wir diese Entscheidungen mit Kopf statt Bauch treffen. Stattdessen sammeln wir Berge an Information, um eine fundierte, faktenbasierte und „gute“ Entscheidung zu treffen. Damit stehen wir aber schon vor dem nächsten Dilemma, zwischen unserer eigenen Sorgfaltspflicht, uns so gründlich wie möglich zu informieren, und der pragmatischen Notwendigkeit, ein Überangebot an Daten auf die wesentliche und entscheidungsrelevante Information zu reduzieren. Wir kennen das wohl alle: Es gibt diesen Punkt, an dem die Kosten, die Zeit oder der Aufwand für immer mehr Information stärker ansteigen als der zu erwartende Nutzen von Genauigkeit.
Das Sammeln von Informationen und Daten scheint im digitalen Zeitalter von Big Data vermutlich der einfachste Schritt zu sein. Noch nie waren grundsätzlich so viele Daten wie heute vorhanden. Aber, die meisten dieser Daten sind im Besitz großer Firmen und werden, wenn überhaupt, nur teuer verkauft und stehen der Öffentlichkeit in der Regel nicht zur Verfügung. Oder sie sind zwar verfügbar, liegen aber isoliert in Datenspeichern. Es kommt noch eine zweite Dimension ins Spiel: Wie beschaffe ich die für meinen Entscheidungskontext „richtigen“ Daten? Wenn wir aber an gute Daten kommen und diese verantwortungsvoll verknüpfen können, wie ordne ich die aus Daten gewonnene Information richtig ein? Und vor allem, wie handle ich auf der Grundlage der gewonnenen Information? Diese Fähigkeit einer „Data Literacy“ ist im 21. Jahrhundert wohl die zentrale Kompetenz.
Viktor Mayer-Schönberger vom Oxford Internet Institute macht noch auf einen weiteren Punkt aufmerksam: „Das Problem ist, dass wir glauben, wir brauchen immer mehr Daten. Daten sind gut, aber alleine helfen sie nicht bei Entscheidungen“. Was wir also brauchen, sind einerseits gute Strukturen, um die vorhandenen Daten in Information zu übertragen und zu bewerten.
Und wir brauchen andererseits Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, die gemeinsam die vorhandenen Daten analysieren, interpretieren, darüber aus ihren jeweiligen Blickwinkeln diskutieren, um zu gemeinsam getragenen Entscheidungen zu kommen. Für Entscheidungen in Gruppen brauchen wir ein Verständnis dafür, dass der oder die andere die Welt anders sieht und anders bewertet. Und wir selbst auch.
Ein Beispiel, wie man Information, Interpretation und Diskussion verknüpfen kann, ist das Projekt Dataroom, initiiert durch Bodensee-Vorarlberg Tourismus. Der Dataroom ist ein real existierender Ort, an dem verschiedene Menschen aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenkommen, um gemeinsam eine breit abgestützte Entscheidung zu treffen. Ziel des Datarooms ist es, ein gemeinsames Verständnis über die Nutzung von Daten und der richtigen Fragen aufzubauen, damit wir bessere Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Region treffen können.
Mayer-Schönberger macht aber noch auf ein weiteres Problem aufmerksam. Daten sind immer nur Bezugspunkte aus der Vergangenheit. Solange sich die Welt nicht verändert, reichen solche Daten aus der Vergangenheit, um Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Wir sehen aber, dass sich die Gewissheiten der Welt so schnell verändern, dass wir selbst kaum noch Schritt halten können. Daten gelangen also an ihre Grenze, der Mensch aber nicht.
Um große Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, bedarf es, so Mayer-Schönberger, unserer menschlichen Vorstellungskraft. Unsere Fähigkeit ist es gerade, uns eine Welt vorzustellen, die gerade nicht existiert, und uns vorzustellen, was wäre, wenn: „Wenn man sich eine Wirklichkeit vorstellt, die es noch gar nicht gibt, dann kommen die neuen Entscheidungsmöglichkeiten“.
Möglicherweise zeigt sich dann auch, dass wir uns nicht zwischen zwei schlechten Optionen aus der Vergangenheit entscheiden müssen, sondern vielleicht eine dritte, bessere, Option schaffen können. Und wenn wir diese dritte Option wählen, dann können wir uns überlegen, wie wir diese alternative Welt, in der diese zusätzlichen Optionen bestehen, in die Wirklichkeit überführen könnten. Das ist das Prinzip, wie das Neue, unter vorherigen Gegebenheiten nicht vorstellbare, in die Welt kommt.
Imagineering nennen dies der St.Galler Kulturwissenschaftler Jörg Metelmann und Harald Welzer von der Stiftung FUTURZWEI. Und gerade bei Fragen der gesellschaftlich-nachhaltigen Transformation benötigen wir Optionen, die nicht aus der Vergangenheit gedacht, sondern die Zukunft gestaltend sind, um so nötiger.






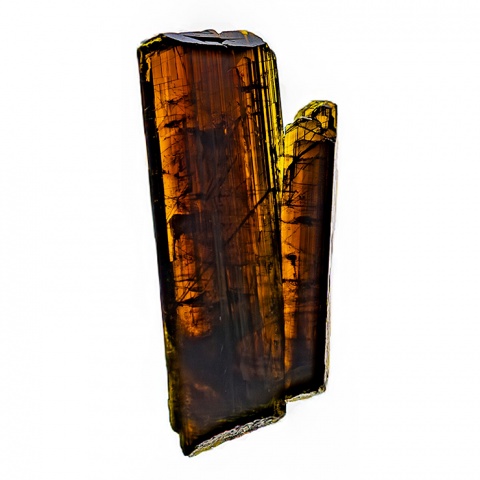






Kommentare