
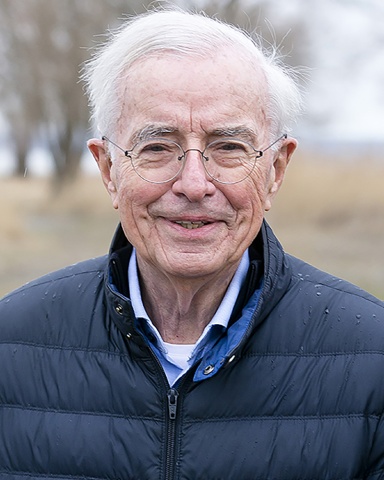
Die mentale Verfassung guter Gemeinschaften
Bestimmte Bereiche sind für die Zukunft unserer Gemeinschaften besonders wichtig, kommen in der öffentlichen Diskussion aber oft zu kurz: Über Voraussetzungen für gelingendes Gemeinschaftsleben in (Menschen)Würde.
Ich war politischer Fußgänger über einige Jahrzehnte mit Erfahrungen in der Kommunal- und Regionalpolitik, mit Einblick in die Bundespolitik, über die Bodenseekonferenz in die Schweiz und die Bundesrepublik Deutschland und über den Ausschuss der Regionen in bescheidenem Umfang in das Geschehen in Brüssel.
Diese Beobachtungen von Gemeinschaften – großen wie kleinen – lassen Verhaltensmuster erkennen, die zeigen, was erfolgreich ist und was in Sackgassen führt, was praktisch funktioniert und was nicht.
Wenn wir über Gemeinschaftsleben nachdenken, befassen wir uns häufig mit dem, was falsch läuft – vor allem damit, was andere falsch machen. Ich möchte heute schauen, ob und wo wir Stärken haben, die uns – allem Negativen zum Trotz – zum Erfolg führen können, wenn wir uns um sie kümmern und sie entwickeln.
Die häufigsten Fehler im Leben, auch von Gemeinschaften, passieren nicht durch falsche Entscheidungen oder Einschätzungen, sondern durch Übersehen schleichender Entwicklungen.
Die menschliche Aufmerksamkeit gilt zuerst dem Ungewöhnlichen und der Gefahr. Die Medienpraxis verstärkt die Tendenz. Dadurch entsteht ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit und ein Hang ins Negative. Themen, die nicht spektakulär daherkommen, interessieren wenig, obwohl sie entscheidend sein können.
Ich wähle an dieser Stelle zwei Bereiche aus, die ich für die Zukunft unserer Gemeinschaften für besonders wichtig halte, die aber in der öffentlichen Diskussion aus den genannten Gründen zu kurz kommen.
Mentale Verfassung
Neben den messbaren Grundlagen von Gemeinschaften – Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft, finanziellem Spielraum oder hoher Schuldenlast – gibt es entscheidende Erfolgsfaktoren: Die Verbreitung von Vorstellungen, Haltungen und Motivationen in der Bevölkerung. Ich nenne das die mentale Verfassung der Gemeinschaften. Eine entscheidende mentale Stärke ist neben Freiheit Verantwortung, im Rahmen des Möglichen zunächst Eigenverantwortung. Das heißt, gelingendes Leben als eigene Aufgabe zu sehen, sich im Rahmen der Kräfte ums Eigene zu kümmern, sich nicht nur als Opfer von Umständen und Strukturen zu fühlen, Leistungsmotivation und Lernwille zu pflegen.
Die Aufgabe ist allerdings nicht nur Sache des Einzelnen, sondern auch Verantwortung der Gemeinschaften mit ihren Institutionen und Diensten. Diese helfenden Strukturen sind keineswegs nur und in erster Linie staatliche Profidienste. Es gibt bedeutende Leistungsträger, die in Eigeninitiative wichtige Leistungen flächig anbieten. Manche Beobachter unterschätzen die Kraft dieses Engagements in Familien, im Ehrenamt, in Gemeinden, Gesinnungs- und Glaubensgemeinschaften und auch in Unternehmen mit guter Kultur der Zusammenarbeit. Diese sich selbst organisierenden Dienste erhöhen Qualität und Breite des Angebots von Leistungen in der Gemeinschaft. In Vorarlberg engagiert sich fast die Hälfte der über 15-Jährigen drei Stunden pro Woche ehrenamtlich – ein beachtlicher Wert. Bei Ermüdung der Leistungsfähigkeit in Familie und Ehrenamt wäre ein Ersatz durch professionelle staatliche Dienste weder personell noch finanziell möglich, es würde zur Reduzierung des Angebots an Leistungen führen und damit zum Verlust von Chancen für Alt und Jung.
Verantwortung ist also der Zwilling der persönlichen Freiheit, die eben nicht nur darin besteht, zu tun, was man gerade will. Freiheit ist mit Verantwortung für sich und andere verbunden. Man schuldet den Gemeinschaften Beteiligung und Mitwirkung. Sie laufen nicht von alleine. Es gibt neben Menschenrechten auch Menschenpflichten. Beides ist für ein Leben in Würde entscheidend.
Verantwortung ist mühsamer und langweiliger als Freiheit. Daher ist sie weniger populär. Die ausgewogene Pflege von Eigenverantwortung, Selbstentfaltung, Leistung, Fleiß und Solidarität mit jenen, die sich nicht selbst helfen können, gibt der Gemeinschaft viel Kraft. Eine solche Gemeinschaft ist fast unschlagbar und steht, was immer großräumig passiert, in jedem Fall besser da als die, die das vergessen oder nie verstanden hat.
Handlungsfähigkeit der Gemeinschaft – Vernunft und Emotion
Wenn man verstehen will, was Gemeinschaften zusammenhält, handlungsfähig macht und viele Chancen und gutes Miteinander entstehen lässt, helfen als Maßstab nicht nur Wissenschaft, Gruppenforderungen und Statistik, sondern auch und nicht zuletzt Hausverstand und Grundanstand.
Der Hausverstand ist eine Form angewandter Vernunft, ein wichtiges kontrollierendes Denkwerkzeug – natürlich nicht unfehlbar, aber gut zu gebrauchen, wenn er offen ist für Kritik und bereit zur Korrektur bei gut gesicherten wissenschaftlichen Ergebnissen. Er verbindet Alltagserfahrung mit Augenmaß und sieht damit, was im wirklichen Leben konkret stattfindet. Das ist eine große Stärke.
An sich begründbare Forderungen führen in der Praxis häufig zur Überforderung der Gemeinschaften. Das ist eine Schwäche vieler Spezialisten, Theoretiker und Interessenvertreter. Sie tun sich oft schwer, das Ergebnis in Summe und in der Praxis zu sehen. Schon ein Seitenblick auf das Ganze wäre oft ein Gewinn.
Der Hausverstand hat Augenmaß. Er weiß, dass es bei aller Geduld der Menschen Grenzen der Belastbarkeit und damit auch der Akzeptanz gibt. Wenn man Mehrheiten überzeugen muss, sollte man auch spüren, wo Kräfte überfordert werden.
Wenn es um Geld geht, lässt der Hausverstand die Grundrechnungsarten gelten. Zwei und zwei ist vier und nichts anderes und zwar immer und auf Dauer. Das Einschalten des Hausverstandes bewährt sich sehr. Ebenso wichtig ist die Einsicht, dass ohne Verbreitung von Grundanstand und Haltung, Charakter (zum Beispiel Handschlagqualität), Courage, ohne Ethik kein Staat zu machen ist. Die Ethik kann sich nicht nur auf Selbstentfaltung und Ego konzentrieren, sondern muss ausgewogen auch die Beziehung zu anderen und damit Rücksichtnahme und zumutbare Hilfe in Not sowie Zusammenarbeit in der Gemeinschaft im Auge haben und Respekt gegenüber jedem Menschen.
Zur Zusammenarbeit in der Gemeinschaft gehört auch die Pflege von Grundkonsens. Funktionierende Demokratie setzt eine ausreichende Zahl von aktiv Beteiligten eingebettet in einen Grundkonsens voraus. Konstruktive Veränderung, Gestaltung der Gemeinschaft findet nur Mehrheiten, wenn das Gemeinsame stärker ist als das Trennende.
Deshalb ist die Pflege gemeinsamer Haltungen und Standpunkte so wichtig und zivilisierte Diskussion bei unterschiedlicher Meinung. Nur auf diese Weise entstehen Fähigkeit und Wille einer Mehrheit zu praktischer Zusammenarbeit im Kompromiss.
Fehlen dieser Konsens und Wille, ist die Stabilität brüchig, auch wenn Mehrheiten momentan vorhanden sind. Es ist im Übrigen leichter, eine Mehrheit zu finden, dass es so nicht (weiter) geht als eine Mehrheit zu finden, wie es konkret weitergeht. Wenn man es aber nicht schafft, einen Kompromiss zu finden, wie es konkret weitergeht, vergeigt man unter Umständen die eigene Zukunft. Demokratie muss handlungsfähig sein.
Durchdenken mit Hausverstand und Sachverstand allein genügt nicht. Möglich machen heißt mehrheitsfähig machen der notwendigen Inhalte. Es genügt nicht, recht zu haben. Man muss für das Richtige und Notwendige Mehrheiten finden.
Nun ist der Mensch keineswegs nur Logiker. Er wird stark spontan und durch Gefühle und Erwartungen gesteuert. Das ist wesentlicher Teil unserer Natur und kein Mangel. Verkopfte Leute verstehen das schwer. Das gilt für`s Private wie für die Gemeinschaft. Ohne Emotion kämen wir nie zum Heiraten. Ohne Leidenschaft kann man kein Unternehmen führen und ohne Stimmung keine Wahl gewinnen.
Emotion schlägt Verstand im Konfliktfall häufig. Das Logische und das Sachargument haben den Nachteil, dass sie als störende Bremse gegen spontane Wünsche oft mit langweiligen Einwendungen und Unterscheidungen arbeiten müssen, um der Wirklichkeit gerecht zu werden. Ohne Emotion steht das sachliche Argument alleine, konkurriert mit hochgeschraubten negativen Emotionen und gewinnt häufig keine Mehrheit. Die negative Behauptung und die negative Emotion sind zumindest in der Erstwirkung der Meinungs- und Stimmungsbildung zehnmal stärker als das Sachargument.
Umso wichtiger ist – und ich gäbe viel dafür –, wenn es gelänge, eine Mehrheit davon zu überzeugen, dass positive Emotionen wie Vertrauen, Zuversicht, Wertschätzung und Zuwendung, aber auch Freude an Leistung und Wir-Gefühl, Zusammenhalt gegenüber negativen Emotionen wie maßlosem Misstrauen, Angst und Frust, Neid oder gar Verachtung und Hass überwiegen sollen.
Bei der Pflege positiver Emotionen ist überall, in Erziehung, im privaten Gespräch und in der Politik Luft nach oben. Wir brauchen verbreitete positive Emotionen wie einen Bissen Brot, um die Zukunft zu bewältigen. Bei Überwiegen negativer Gefühle blockieren wir uns selbst und ersticken die Fähigkeit, mit Leidenschaft, kreativ und entschlossen zum Nutzen aller zu handeln.
Die Stärkung positiver Emotion gelingt nach meiner Erfahrung weniger als moralischer Appell, sondern eher durch Anknüpfen an breit gelebte Praxis der Zusammenarbeit in Familien, Vereinen, Gemeinden, Gesinnungs- und Glaubensgemeinschaften, auch in Firmen mit guter Kultur der Zusammenarbeit. Diese Kräfte kann man pflegen, sichtbar machen, erziehend trainieren, fördern und koordinieren. Man kann vor allem mitmachen. Positive Emotionen finden sich auch beim Einzelnen als Leistungs- und Lernwille, Fleiß, Freude am etwas Schaffen (jedes Kind will zeigen, was es kann), als Solidarität in Gestalt von Rücksichtnahme und Hilfe in Not und auch als zunehmender Wunsch nach Orientierung, Sinn und Ziel.
Ein wesentlicher Teil der Kunst des Politischen besteht in der Zusammenführung von vorausschauender Vernunft mit (positiver) Emotion. Die Umsetzung braucht Logik (und Differenzierung und Kompromiss), die breite Akzeptanz neben dem überzeugenden Argument auch Emotion, Stimmung, für konstruktive Politik positive Stimmung. Ohne Stimmung gibt es in der Regel zu wenig Stimmen.
Hinweis der Redaktion: In einem Artikel in der Oktober-Ausgabe wird Herbert Sausgruber auf zwei weitere zentrale Grundlagen gelingender Gemeinschaften eingehen: Auf das „offene Wir – Identität, die nicht vom Feindbild lebt“ und auf „Handlungsfähigkeit des freien Europas“.

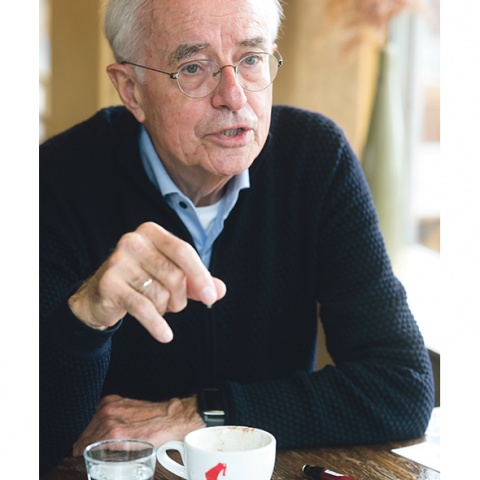










Kommentare