
Make Facts Great Again
Fake News begegnen uns täglich – doch wie erkennt man sie wirklich? Zwischen Bücherregalen und Algorithmen ist ein Projekt entstanden, das junge Menschen genau dafür stark macht. Was als Schulpraktikum begann, wurde zu einer überraschend wirksamen Aufklärungsoffensive.
Von Patrick Labourdette (VLB), Amaya Frei und Angelina Loacker (BG Gallusstraße Bregenz), Julia Münnich (HTWK Leipzig) und Klara Strolz (VLB) – Artikel verfasst mit Unterstützung von ChatGPT.
Die stillsten Revolutionen sind oft die wirksamsten. Eine solche hat sich in den vergangenen Monaten in der Vorarlberger Landesbibliothek vollzogen. Unter dem Titel „Stranger Facts – Fake News entlarven und kritisch denken lernen“ entstand dort ein ungewöhnliches Bildungsprojekt. Initiiert wurde es von einem erfahrenen Bibliotheksmitarbeiter – gemeinsam mit zwei 15-jährigen Schülerinnen, die sich im Rahmen eines Public-Service-Praktikums ein Schuljahr lang wöchentlich in der Bibliothek engagierten. Unterstützt wurden sie dabei von einer jungen Bibliotheksmitarbeiterin sowie einer Studentin der Bibliotheks- und Informationswissenschaft.
Gemeinsam entwickelten sie ein interaktives Format, das eindrucksvoll zeigt: Bibliotheken sind heute weit mehr als stille Wissensspeicher. Sie sind lebendige Orte des Austauschs und der Neugier, offene Bühnen für Experimente und Debatten. Sie können zu Laboren für kritisches Denken, Medienkompetenz und politische Bildung werden – Räume, in denen nicht nur Bücher, sondern auch Ideen miteinander in Resonanz treten. Dieses Projekt hat den Zauber der Bibliothek spürbar gemacht: ein Ort, an dem junge Menschen nicht nur Fragen stellen, sondern auch gemeinsam Antworten finden.
Fake News erkennen statt nur googeln
Wie entsteht Desinformation, warum verbreitet sie sich – und wie kann man sie erkennen? Diesen Fragen haben sich die beiden Schülerinnen in einem gesellschaftsrelevanten Projekt gestellt, das sie nicht nur besucht, sondern auch aktiv mitgestaltet haben. Im Zentrum steht dabei ein Actionbound: Eine digitale Schnitzeljagd, die ab sofort in der Landesbibliothek gespielt werden kann. Dabei prüfen die Teilnehmenden Quellen, hinterfragen Fakten und werfen einen kritischen Blick auf Algorithmen – spielerisch und gleichzeitig mit Tiefgang.
Los geht es mit einem Impulsvortrag in klarer Sprache, der direkt an der Lebensrealität Jugendlicher anknüpft – bei TikTok, Insta oder WhatsApp, wo sich oft Fakten und Meinungen vermischen. Und wer könnte dabei besser helfen, den eigenen Blick zu schärfen, als Gleichaltrige selbst?
Wissen als Schatzsuche – mit Story, Sound und KI
Die digitale Schnitzeljagd folgt einem dichten Storytelling: Filmszenen, mit dem Smartphone aufgenommen, strukturieren die Stationen und schlagen den dramaturgischen Bogen – von der ersten Konfrontation mit Fakes bis zur abschließenden Reflexion. Der Soundtrack, produziert mit dem KI-Tool Suno, unterlegt die Szenen mit eigens komponierter Musik und schafft Atmosphäre.
Auch bei der inhaltlichen Gestaltung spielte Künstliche Intelligenz eine zentrale Rolle: ChatGPT half bei der Entwicklung von Drehbüchern, generierte Infografiken und illustrierte die Bound-Stationen. So wurde der Workshop selbst zum Beispiel für den kreativen Einsatz neuer Technologien – nicht als Spielerei, sondern als Mittel, komplexe Inhalte zugänglich zu machen.
Bibliothek als Bühne – Vertrauen als Methode
„Stranger Facts“ ist mehr als ein Workshop. Die Bibliothek wird hier zum Lernraum, in dem Jugendliche Inhalte gestalten – mit Verantwortung und Freiraum. Das Vertrauen, das den beiden Schülerinnen entgegengebracht wurde, zeigt Wirkung: Sie waren nicht nur Teilnehmende, sondern gestalteten das Projekt aktiv mit und trugen es weit über die Bibliothek hinaus. In ihrer Schule und im privaten Umfeld haben sie Gespräche angestoßen – über Desinformation, Medienlogiken und politische Bildung. Besonders bemerkenswert: Sie haben ihre Lehrerinnen und Lehrer dafür sensibilisiert, diese Themen stärker im Unterricht aufzugreifen. Was als Praktikum begann, hat so Impulse in den schulischen Alltag getragen – durch Eigeninitiative und Überzeugungskraft.
Sechs Ziele, ein tragfähiger Ansatz
Das Projekt verfolgt sechs klare Ziele, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken: Es will kritisches Denken fördern und zugleich die Medienkompetenz der Jugendlichen stärken. Dabei setzt es auf Peer-to-Peer-Lernen, also darauf, dass junge Menschen sich gegenseitig unterstützen und voneinander lernen. Gleichzeitig soll die Bibliothek als Kompetenzzentrum sichtbar werden – ein Ort, an dem neue Methoden ausprobiert und erprobt werden können. Wichtig ist auch die nachhaltige Nutzung: Dafür sorgt eine digitale App, die das Projekt dauerhaft verfügbar macht. Und schließlich zeigt das Projekt, dass die Idee nicht einfach kopiert, sondern weiterentwickelt werden soll – damit andere Bildungseinrichtungen darauf aufbauen und eigene, passende Formate entwickeln können.
Ein Projekt zur rechten Zeit
In einer Zeit, in der Desinformation politische Prozesse gefährdet und das Vertrauen in Fakten zunehmend schwindet, ist „Stranger Facts“ ein echter Lichtblick. Dieses Projekt schließt eine Lücke, die Schulen oft hinterlassen: politische Bildung, die nicht nur informiert, sondern auch inspiriert – nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Hier treffen Neugier und Offenheit aufeinander, getragen von dem Vertrauen, dass Jugendliche mehr können als man ihnen gemeinhin zutraut.
„Stranger Facts“ zeigt, wie politische Bildung lebendig werden kann – indem sie Räume schafft, in denen junge Menschen sich selbst erproben, gemeinsam Fragen stellen und Antworten finden. Für alle Beteiligten war das ein Glücksfall – und zugleich ein Modell für diejenigen, die Bildung neu denken wollen: interaktiv, partizipativ und relevant.



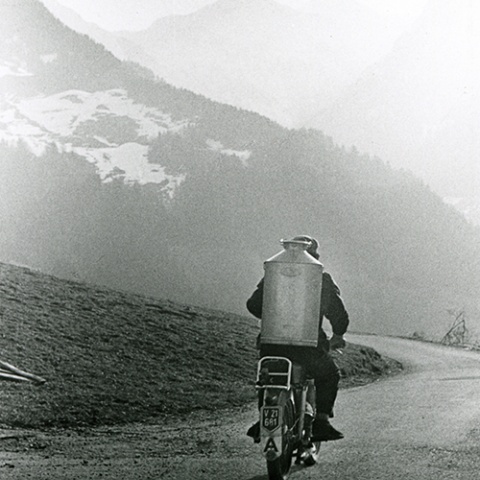
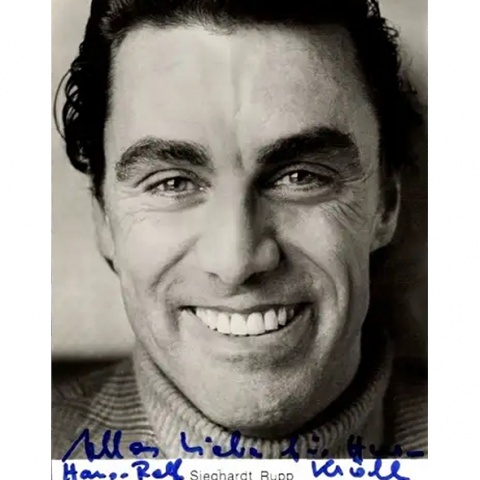








Kommentare