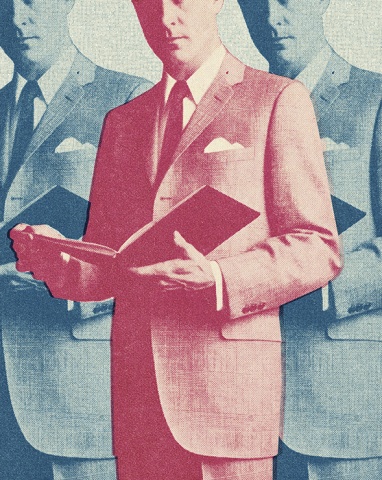
Von Spitzenjobs, Aufstiegsambitionen und Überstunden
In der Debatte um Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen wird in der Öffentlichkeit traditionell davon ausgegangen, dass sie zu einem Großteil durch Diskriminierung gegen Frauen zu erklären sind. Empirische Daten von über 1100 Rechtsanwälten mit sechsstelligen Gehältern zeichnen ein deutlich differenzierteres Bild.
In der Literatur zur Erklärung von Gehaltsunterschieden zwischen Männern und Frauen wird immer wieder auf die „long hours“ in Spitzenjobs als ein Mosaiksteinchen zur Erklärung dieser Unterschiede verwiesen, die gerade in sehr gut bezahlten Berufen immer noch substanziell sind. Der Verweis auf „long hours“ bedeutet, dass man in Spitzenjobs nicht einfach nach 40 Stunden (oder noch weniger) nach Hause geht, sondern dass man in solchen Jobs sehr viel mehr arbeiten muss, insbesondere weil Klienten das erwarten.
Wenn beispielsweise ein Klient eine millionen- oder milliardenschwere Fusion mit einer anderen Firma über die Bühne bringen möchte, ist es undenkbar, dass die federführenden Rechtsanwälte in der mit der Fusion beauftragten Kanzlei um 16.00 Uhr den Stift fallen lassen. Solche Situationen sind weit verbreitet, wenn es um hochspezialisierte Berufe geht, insbesondere in hochpreisigen Dienstleistungsbranchen, wie etwa in der Unternehmensberatung, der Finanzindustrie oder eben in großen Rechtsanwaltsfirmen.
Die Notwendigkeit, für Klienten auch außerhalb der normalen Dienstzeiten verfügbar zu sein und deren Anliegen zu bearbeiten, wird oft als einer der Gründe für Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen betrachtet, weil Frauen aufgrund ihrer familiären Verpflichtungen weniger im Stande wären, solche „long hours“ zu leisten. Diese Jobs mit „long hours“ würden aber überdurchschnittlich gut bezahlt, woher dann Geschlechterunterschiede im Gehalt kämen. Dabei wird zum einen nicht hinterfragt, ob Frauen vielleicht weniger Interesse an solchen Jobs mit „long hours“ haben. Dafür gibt es aber viele Hinweise, über die ich im Abschnitt über „Selektion“ schreibe. Wenn diese Hinweise aber zutreffen, und das tun sie meines Erachtens, dann haben die Gehaltsunterschiede in erster Linie mit der Wahl des Berufs und nicht mit dem Problem von „long hours“ zu tun. Zum anderen ist die Evidenz für „long hours“ als Ursache für Gehaltsunterschiede eher dünn gesät und ambivalent. Eine Studie von Ghazala Azmat von der Queen Mary University in London und von Rosa Ferrer von der Pompeu Fabra Universität in Barcelona hat sich die Sache genauer angeschaut.
Azmat und Ferrer hatten Zugang zu Daten von über 1100 Rechtsanwälten in den USA. Diese sind Teil einer repräsentativen Stichprobe aller US-amerikanischen Rechtsanwälte. Für die über 1100 Rechtsanwälte konnten die Autorinnen vor allem auch Daten über die Leistung der Rechtsanwälte für ihre jeweiligen Kanzleien auswerten. Dabei spielen zwei Faktoren eine entscheidende Rolle: erstens die Anzahl an abrechenbaren Arbeitsstunden (also jene Stunden, die man einem Klienten verrechnen konnte); zweitens das eingeworbene Auftragsvolumen neuer Kunden (also in welchem Umfang ein Rechtsanwalt den Umsatz einer Kanzlei durch die Gewinnung neuer Kunden erhöht). Zusätzlich hatten die Autorinnen Daten über die Ausbildung, das Geschlecht, das Alter, die Berufserfahrung (in allen bisherigen Arbeitsstellen), die Spezialisierung (auf bestimmte Rechtsbereiche) und ob jemand in der jeweiligen Kanzlei innerhalb von zwölf Jahren zum Partner befördert wurde oder nicht.
Etwa 40 Prozent der Rechtsanwälte waren Frauen und diese verdienten im Schnitt zwölf Prozent weniger als Männer. Die Durchschnittsverdienste (im Studienjahr 2007) lagen bei 150.000 US-Dollar für Männer und 132.000 US-Dollar für Frauen. Die statistische Berücksichtigung der Hintergrunddaten (Ausbildung, Spezialisierung, Erfahrung, Alter, Firma) konnte etwa die Hälfte der Gehaltsunterschiede erklären.
Die andere Hälfte ließ sich durch unterschiedliche Produktivität von Männern und Frauen erklären. Männer verrechneten etwa 150 Stunden mehr ihren Klienten (was ein üblicher Leistungsindikator ist). Das ist ein Unterschied von circa zehn Prozent gegenüber Frauen. Dabei war es nicht so, dass Männer einfach generell einen höheren Anteil ihrer Gesamtarbeitszeit ihren Klienten verrechneten. Das Verhältnis von gearbeiteten zu verrechneten Stunden war gleich für Männer und Frauen. Also arbeiteten Männer circa zehn Prozent länger in ihren Unternehmen. Männer brachten ihren Kanzleien im Schnitt auch rund 30.000 US-Dollar mehr an neuen Umsätzen durch neue Kunden. Beide Indikatoren zeigen also deutliche Leistungsunterschiede. Diese sind besonders groß bei Anwältinnen mit jungen Kindern, die im Schnitt etwa 200 Stunden weniger verrechnen als Männer (selbst als Männer mit jungen Kindern). Wenn man diese Leistungsunterschiede berücksichtigt, sind die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen vollständig erklärbar.
Frauen werden auch seltener zur Partnerin befördert als Männer. Aber die Autorinnen zeigen, dass auch dieser Unterschied auf Leistungsunterschiede und noch einen weiteren Faktor zurückzuführen sind, also nicht etwa die Folge von Diskriminierung von Frauen sind. Der zweite Faktor betrifft die Karriereambitionen. Auf die Frage, wie wichtig ihnen die Beförderung zum Partner in ihrer Kanzlei auf einer Skala von 1 bis 10 ist, gaben nur 32 Prozent der Frauen eine 8 oder mehr an, während das bei den Männern 60 Prozent waren.
Geringere Ambitionen gehen Hand in Hand mit geringeren Arbeitszeiten, weniger Wochenendarbeit und Teilnahme an beruflichen (Kunden)Veranstaltungen und erklären dadurch wiederum einen Teil der Leistungsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und damit können dann die Gehaltsunterschiede und unterschiedlichen Beförderungswahrscheinlichkeiten erklärt werden. „Long hours“ spielen also in der Tat eine Rolle, sind aber kein Beleg für Diskriminierung gegen Frauen.










Kommentare