
Trumps Zölle und Europas Bürokratie
Die Handelspolitik von Donald Trump gilt als protektionistisch und sorgt für Irritationen. Besonders die im neuen „US-EU-Deal“ verankerten US-Zölle von pauschal 15 Prozent – bei Stahl und Aluminium sogar 50 Prozent – dürften der US-Wirtschaft und den US-Konsumenten schaden. Hohe Zölle, ein fragmentierter Weltmarkt und das Risiko eskalierender Handelskonflikte sind ökonomisch höchst problematisch. Zudem ignoriert die US-Regierung ihren Dienstleistungsüberschuss und fokussiert allein auf das Defizit im Güterhandel. Das Abkommen mit der EU wirkt daher abstrus: Warum ein Deal, wenn Freihandel doch überlegen wäre?
Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse
Vor der jetzigen Trump-Regierung war die EU protektionistischer als die USA. Laut WTO lag der durchschnittliche EU-Zollsatz auf US-Industriegüter bei 4,5 Prozent, bei Agrarprodukten sogar bei 14,7 Prozent. Die USA erhoben im Gegenzug nur 3,9 Prozent auf Industriegüter aus der EU und 7,5 Prozent auf Agrarimporte. Doch Zölle sind nicht alles. Nichttarifäre Handelshemmnisse – etwa technische Standards oder komplexe Zulassungsverfahren – erschweren den internationalen Austausch oft stärker als klassische Zölle. Hier ist die EU führend und insofern protektionistischer als die USA.
Unstrittig ist: Sowohl die EU als auch die USA schöpfen ihr wirtschaftliches Potenzial nicht aus. Zu viel Bürokratie, viele unnötige Regulierungen und eine interventionistische Klimapolitik wirken wie versteckte Zölle. Der geplante CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU mit Klimazöllen ab 2026 und umfangreichen Dokumentationspflichten ist nur ein Beispiel. Solche Barrieren sind häufig ideologisch motiviert oder von Lobbyinteressen getrieben. Sie behindern den Handel und bremsen das Wachstum des Westens.
Wachstum durch Deregulierung
Die US-Regierung hat den Amerikanern mehr Wirtschaftswachstum versprochen. Die Deregulierung in mehreren Politikfeldern – insbesondere in der Klima- und Energiepolitik – zeigt, wie wichtig ihr Wachstum ist. Vor diesem Hintergrund greift die amerikanische Handelspolitik einen Ansatz der 1960er- bis 1990er-Jahre auf: Ersetze nichttarifäre Handelshemmnisse durch Zölle, um diese anschließend gemeinsam abzubauen.
Zentrale Elemente des neuen US-EU-Abkommens passen zu diesem Ansatz. Die EU-Zölle auf US-Industriegüter sollen auf null sinken – die US-Zölle hingegen bleiben vorerst bestehen. Entscheidender als der Zollabbau ist jedoch die geplante Reduktion nichttarifärer Hemmnisse. Gelingen kann das nur, wenn bestehende bürokratische Regulierungen insgesamt vereinfacht werden, wovon nicht nur exportierende Unternehmen, sondern alle profitieren würden. Ziel des Deals wäre gemäß dem Weißen Haus, europäische Vorschriften im Industrie- und Agrarbereich für US-Unternehmen besser handhabbar zu machen. Im digitalen Bereich versprechen beide Seiten, elektronische Dienstleistungen dauerhaft zollfrei zu halten und neue regulatorische Hürden zu vermeiden. So könnte der Handel sogar zunehmen, insbesondere in gerade aufstrebenden Sektoren wie KI.
Unerfüllbare Versprechen
Der Deal enthält allerdings auch Elemente, die widersprüchlich wirken. Die USA bestehen weiterhin auf pauschalen Zöllen. Die EU verpflichtet sich im Gegenzug, über drei Jahre hinweg Energie im Wert von 750 Milliarden Dollar aus den USA zu importieren und 600 Milliarden Dollar zusätzlich zu investieren. Das erinnert an Schutzgeld und ist für die EU realistischerweise nicht umsetzbar: Die EU-Kommission kann weder den Energiehandel zentral steuern noch Investitionsströme garantieren. Warum also solche Versprechen?
Die Antwort liegt in einer politökonomischen Logik. Die USA bauen intern Vorschriften ab. Klassische Appelle an die EU, ihre nichttarifären Handelshemmnisse zu senken, sind seit Jahren wirkungslos verpufft. Auch die EU-Kommission hätte objektiv ein Interesse an Deregulierung und Bürokratieabbau, um wirtschaftliches Wachstum zu stärken, sodass deutlich höhere Militärausgaben finanzierbar und die Staatsschulden tragbar bleiben.
Die Zölle der USA schaffen nun ein glaubwürdiges Druckmittel. Die EU liefert einerseits nur vage und schwer verbindlich überprüfbare Zusagen zum Regulierungsabbau, aber andererseits klar messbare und politisch symbolträchtige Versprechen bei Energieimporten und Investitionen in den USA. So sichern sich die Amerikaner Flexibilität: Wenn die EU beim regulatorischen Abbau Fortschritte erzielt, kann Washington großzügig über die absehbare Nichterfüllung der Energieversprechen hinwegsehen. Anderenfalls kann es hart nachfordern. Der EU könnten also bald weitere Zolldrohungen wegen faktischer Nichterfüllung des „Deals“ drohen.
Diese Strategie ist auch geopolitisch motiviert. Ein isolierter Zollkonflikt zwischen den USA und China hätte bloß Handelsumgehungen gefördert. Der große „Zollschock“ zwang hingegen nahezu alle US-Handelspartner an den Verhandlungstisch. Die EU verspricht nun zudem, keine Trittbrettfahrer zu dulden.
So offenbart sich unter wirtschaftlichen und geopolitischen Zwängen eine nicht völlig illiberale Logik: Der wirtschaftspolitische Druck aus den USA zwingt westliche Partner zu mehr Marktöffnung durch Deregulierung. Die EU profitiert im Gegenzug von besseren Bedingungen im transatlantischen Handel im Vergleich zu China. Funktioniert all das, dürfte es den Westen letztlich stärken. Es wäre dann eine Wiederholung von Trumps Erfolg, Europa zur Aufrüstung zu bewegen.
Dennoch bleibt der Freihandel zwischen demokratischen Staaten das ökonomisch überlegene Prinzip. Angesichts regulatorischer, geopolitischer und innenpolitischer Hürden könnten jedoch unkonventionelle Wege notwendig sein, um ihm näherzukommen. Ob der neue transatlantische Deal ein solcher Weg ist, wird sich zeigen. Die EU täte jedenfalls gut daran, Wirtschaftswachstum weniger zu behindern und den US-Präsidenten als praktischen Vorwand für den überfälligen Bürokratieabbau zu nutzen.





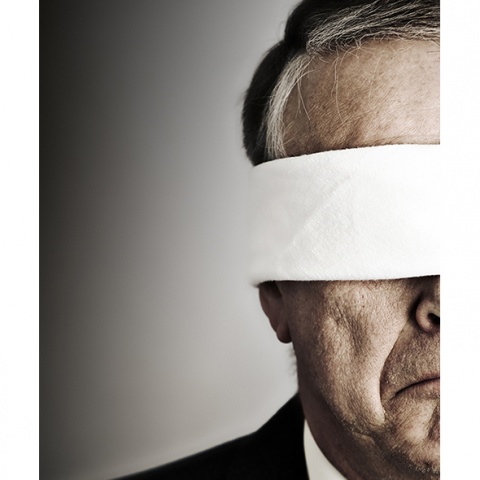








Kommentare