
Ein Spital reicht für Vorarlberg
Dem Gesundheitswesen steht ein Paradigmenwechsel bevor: Bund, Länder und Gemeinden haben sich darauf geeinigt, dass die Versorgung künftig verstärkt in Arztpraxen, neuen Gesundheitszentren und Ambulanzen stattfinden soll. Spitalskapazitäten werden reduziert. Das bringt auch das Aus für Standorte. Auch in Vorarlberg. Eine Analyse von Martin Schriebl-Rümmele.
Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sind immer wieder ein kurioses Politikum: Immerhin geht es dabei nicht um weniger als die Frage, wie die Steuergelder verteilt werden. Und das wird im Artikel 15a der Verfassung für vier Jahre festgeschrieben. Konkret geht es dabei um mehr als 35 Milliarden Euro. Gefeilscht wird dabei wie am Markt: Wohnbaugelder werden getauscht mit Geld für Kindergärten, Straßenbau mit Gesundheit.
Gerade bei der Gesundheit schlagen immer wieder die Begehrlichkeiten der Verhandler die Vernunft. Denn im Gesundheitswesen geht es um viel Geld und um steigende Kosten. Länder und Gemeinden betreiben in Österreich die Krankenhäuser und bekommen dafür von den Krankenkassen nur einen gedeckelten Pauschalbetrag. Umgekehrt bezahlen die Kassen die gesamte ambulante Versorgung. Weil die Länder alles, was über die Zahlungen der Kassen hinausgeht, selbst in den Spitalstopf zahlen müssen und letztlich auch die Defizite der Spitäler abdecken, forderten sie nun rund 500 Millionen Euro mehr. Bekommen haben sie 200 Millionen – aber nur gegen die Zusage, bei den Kosten zu bremsen. Konkret hat man sich auf sogenannte Kostendämpfungspfade in Sachen Gesundheit und Pflege verständigt. So dürfen die Gesundheitsausgaben künftig jährlich um 3,2 Prozent steigen – derzeit sind es 3,6 –, jene für die Pflege um 4,6 Prozent.
Festgehalten wird in der Vereinbarung explizit der „Abbau des akutstationären Bereichs bei gleichzeitigem Ausbau der ambulanten Versorgung unter Sicherstellung des Zugangs zu und der Verfügbarkeit von allen notwendigen Leistungen“. Und weiter: „Im Bereich der Primärversorgung sind Primärversorgungseinheiten zu schaffen.“ Deutlich wird das Papier bei der Beschreibung, wie die neuen Primärversorgungseinheiten auszusehen haben: als Gruppenpraxis, als Ambulatorium oder als Netzwerk von ausschließlich „freiberuflich tätigen Ärzten und Ärztinnen, anderen nichtärztlichen Angehörigen von Gesundheits- und Sozialberufen oder deren Trägerorganisationen.“ Kurz: Verschiedene Gesundheitsberufe arbeiten in einem Zentrum zusammen, die Öffnungszeiten sollen möglichst ausgedehnt werden. „Für die Gesundheitsversorgung der Zukunft sind gerade in ländlichen Regionen neue und innovative Modelle nötig. Es ist das explizite Ziel der Gesundheitspolitik, die wohnortnahe ambulante Versorgung auszubauen und zu stärken und die Spitalsambulanzen zu entlasten“, sagte dazu Vorarlbergs Gesundheitslandesrat Christian Bernhard.
Was auf den ersten Blick vernünftig klingt, wird österreichweit massive Veränderungen im Spitalsbereich mit sich bringen. Die Zahl der Standorte wird deutlich zurückgehen. In Wien sieht etwa das bereits 2011 beschlossene Spitalskonzept vor, dass ab 2030 gerade einmal sechs Gemeindespitäler die Gesundheitsversorgung übernehmen sollen. Das AKH bleibt in seiner Sonderrolle als Universitätsspital bestehen. Gleich mehrere Standorte wurden oder werden geschlossen. In der Steiermark soll es 2035 nach den Plänen des Landes in sechs steirischen Regionen je ein Leitspital geben. Der Zentralraum als siebente Region mit der Landeshauptstadt Graz ist ein Sonderfall, hier soll es drei Spitäler geben. Derzeit gibt es in der Steiermark 23 Spitalsstandorte. Künftig werden es neun sein. In Kärnten wird hinter vorgehaltener Hand bereits diskutiert, dass zwei Krankenhäuser reichen werden. Spricht man mit Vertretern im Hauptverband der Sozialversicherungen und dem Gesundheitsministerium, hört man für Vorarlberg die Zahl EINS. Soll heißen: ein Krankenhaus reicht. Feldkirch. In Vorarlberg will das soweit niemand bestätigten. Das Thema ist politisch hochbrisant.
Die Fakten sind allerdings eindeutig. Seit 1990 hat sich die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Vorarlberger Krankenhäusern von 12,5 Tagen auf 6,3 Tage halbiert. Anfang des Jahres startete in Vorarlberg zudem ein Pilotprojekt für das österreichische Gesundheitswesen mit dem Probebetrieb: das „telefon- und webbasierte Erstkontakt- und Beratungsservice“ (TEWEB). Anrufer sollen hier rund um die Uhr von Fachpersonal medizinische Auskunft bekommen. In Notfällen wird die Rettung organisiert. Den Zuschlag als Bestbieter für das System erhielt der US-amerikanische Softwareerzeuger Priority Dispatch, dessen System schon in anderen Ländern, etwa in England oder Australien, ins Gesundheitswesen integriert wurde. „Durch TEWEB soll das wesentliche Ziel der Gesundheitsreform, nämlich die Versorgung von Patienten am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der bestmöglichen Qualität, umgesetzt werden“, sagt Manfred Brunner, der Obmann der Vorarlberger Gebietskrankenkasse (VGKK). Das Angebot der medizinischen Telekonsultation könne auch die Versorgungsstrukturen entlasten. Gemeint sind wiederum primär die stationären Strukturen. Denn diese sind teuer und am Wochenende sind die Spitalsambulanzen oft die einzige Anlaufstelle, wenn die Praxen der niedergelassenen Ärzte geschlossen haben. Das soll sich künftig mit TEWEB und Primärversorgungszentren ändern.
Doch die Reduzierungen von Spitalsstandorten bergen enorme Risiken. Eine der fatalen Auswirkungen wurde etwa im Dezember 2016 in Wien sichtbar, als die Grippewelle deutlich früher und stärker über die Bundeshauptstadt und Österreich hereinbrach. Eine Grippewelle führt normalerweise auch zu einem deutlichen Anstieg der Spitalsaufenthalte. Die Stadt Wien war allerdings völlig überfordert, die Kapazitäten reichten nicht aus. Unzählige Patienten lagen auf Gangbetten. Das Beispiel zeigt ein Grundproblem im Gesundheitswesen: Ähnlich wie bei der Feuerwehr sind Gesundheitseinrichtungen auch dann wichtig, wenn sie nicht benötigt werden. Sie für den Ernstfall aufrecht zu halten, kostet aber viel Geld und ist im Grunde ökonomisch betrachtet extrem ineffizient. Bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie wirklich benötigt werden. Hier liegt die große Gefahr, wenn Krankenhauskapazitäten abgebaut und Spitäler reduziert werden. Wohin das führt, zeigte sich im August 2016, als etwa ein IT-Problem den gesamten Flughafen Wien lahmlegte. Experten kritisierten damals die übertriebene Effizienzsteigerung der Strukturen. Über die Jahre hinweg wurden aus Kostengründen öffentliche Infrastrukturen, aber auch die Versorgungsketten in der Wirtschaft immer weiter optimiert worden – ohne an Redundanzen, also zusätzliche Ressourcen, als Reserve für Notfälle zu denken. Das rächt sich zunehmend. Ein Rädchen greift ins andere; fällt eines aus, kommt das ganze System zum Stillstand. Auffangkonzepte gibt es nicht mehr.
Für die Vorarlberger Krankenhäuser bedeutet diese Entwicklung, dass – auch wenn es ökonomisch von den Kapazitäten her unnötig ist – wohl neben Feldkirch ein zweites Spital im Ländle bestehen bleiben wird. Hinter den Kulissen matchen sich bereits Bregenz und Dornbirn um den Verbleib. „Angesichts der aktuellen Verkehrsentwicklung und Staus zu Stoßzeiten hat Dornbirn bessere Chancen. Zu bestimmten Zeiten gibt es für Bewohner der Rheindelta-Gemeinden kaum ein Durchkommen nach Bregenz“, sagt ein Primararzt. Die Spitalsgesellschaft des Landes fokussiere aber Bregenz – nicht zuletzt, weil Dornbirn als Spital der Stadt nicht zum Verbund gehört. Die Diskussion des Vorjahres zwischen Spitalsgesellschaft und der Stadt um den Hubschrauberlandeplatz in Dornbirn sei bereits ein erstes Zeichen für den Machtkampf hinter den Kulissen gewesen, berichten Insider. Klar ist: Die anderen Regionen werden wohl Primärversorgungszentren erhalten mit längeren Öffnungszentren und breiterem Angebot. Für Regionen wie den Bregenzerwald, das Montafon, aber auch das Rheindelta könnte das sogar deutliche Verbesserungen bringen und den Verlust von zwei bis drei Spitälern sogar wettmachen.






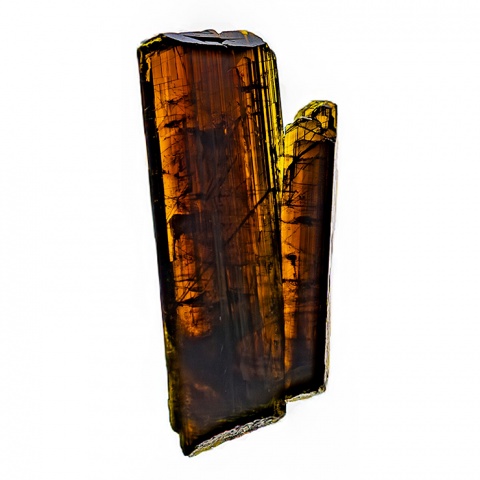






Kommentare