
Götter-Dämmerung
Zwei ehemalige Ärztinnen am Landeskrankenhaus Feldkirch erheben in einem neuen Buch schwere Vorwürfe gegen ihre Kollegen in der Neurochirurgie. Sie sprechen von macht- und karrieregeilen Göttern in Weiß und Pfusch im OP. Vor allem aber zeichnen sie ein Bild von massiven Systemproblemen.
Erschreckende Zustände in neurochirurgischen Abteilungen – darunter auch am LKH Feldkirch – wollen die Neurochirurginnen Marion Reddy und Iris Zachenhofer in ihrem neuen Buch „Dachschaden – Zwei Neurochirurginnen decken auf“ publik machen. Genaue Details bleiben sie zwar schuldig, die Ärztinnen skizzieren aber das Bild einer überarbeiteten und karrieresüchtigen Zunft, in der es ihrer Meinung nach um Operationszahlen, „interessante Patienten“, Narzissmus und möglichst spektakuläre Eingriffe geht. Dabei kämen Patienten auch unnötigerweise unter das Skalpell und würden zum Teil sogar Schaden erleiden. Das Buch polarisiert. Andere Neurologen weisen die Kritik zurück und orten Retourkutschen. Fakten und persönliche Befindlichkeiten würden vermischt.
Es gehe ihnen nicht darum, konkrete Missstände aufzudecken oder gar einzelne Ärzte anzuschwärzen, relativiert Marion Reddy im Gespräch mit „Thema Vorarlberg“, das sei auch datenschutzrechtlich ein Problem. Sie erhebt deshalb auch keine detaillierten Vorwürfe gegen das LKH Feldkirch. Sie wolle nur das gesamtösterreichische System ausleuchten. Und das mache eben Ärzte und Patienten krank. Reddy arbeitete als Neurochirurgin in Wien und als Oberärztin in Feldkirch und wirkt jetzt in Toulouse. Sie verfasste zahlreiche Fachpublikationen. Ihr Hauptkritikpunkt: Das System sei krank. „Demütigungen vonseiten der Vorgesetzten, hierarchische Strukturen, Konkurrenzdruck und Suchtprobleme sind Alltag.“
Nur eine Video-Anleitung
Im Buch berichten die Ärztinnen recht allgemein von Ärzten, die völlig übermüdet operieren, und von fehlenden Ausbildungen. Da wagt sich etwa ein Bandscheiben-Spezialist nur mit einer Video-Anleitung an einen Gehirntumor. Nach der OP ist die junge Patientin im Gesicht halbseitig gelähmt. Die beiden Insiderinnen berichten von Ärzten, die wie selbstverständlich aus Eigenbedarf in den Medikamentenkasten greifen. Dazu komme das übersteigerte Ego: Neurochirurgen gelten als Elite der Medizin, behandeln aber im Alltag meist Bandscheibenvorfälle. Nicht zuletzt deshalb träumen viele von Hirnoperationen, auch wenn die Qualifikation dafür oft fehlt. Die Eitelkeit verbiete es ihnen, bei einer schwierigen OP einen erfahrenen Kollegen um Hilfe zu bitten.
„Die Ärztekammer hat im Februar 2014 eine Studie zur Zufriedenheit von Assistenzärzten publiziert: Die Neurochirurgie gehörte zu den Schlechtesten, über 40 Prozent der Ärzte fühlten sich sehr schlecht ausgebildet. Vor drei Jahren zeigte eine Umfrage unter Neurochirurginnen, dass neun von zwölf Frauen dieses Fach nicht mehr wählen würden“, sagt Reddy. Tatsache sei, dass bereits jetzt allein in Österreich 1300 Ärzte fehlen, viele ins Ausland gehen und dass „viel zu wenige Ärzte noch längerfristig im Krankenhaus arbeiten“ wollen. Reddy will, dass „Ärzte sich endlich einmal wehren gegen diese Zustände, an Neurochirurgien und allen anderen Abteilungen, und dass auch die Politik rasch reagieren muss, damit der Arztberuf im Krankenhaus noch für irgendjemanden interessant ist“.
Eine österreichische Lösung
Die Kritik kommt zu einem Zeitpunkt, an dem tatsächlich viel im Wandel ist. Die EU hat Österreich mit Strafzahlungen gedroht, weil die seit über zehn Jahren gültige Arbeitszeitrichtlinie für Spitalsärzte noch immer nicht umgesetzt ist. Während es in den meisten anderen Ländern bereits Wochenarbeitszeiten von maximal 48 Stunden gibt, dürfen die Klinikärzte in Österreich noch immer 72 Stunden arbeiten – und tun das auch. Das Hauptproblem: Meist sind die Länder als Eigentümer der Spitäler Arbeitgeber und über die Arbeitsinspektorate zugleich Kontrolleure. Nicht selten wurde da in der Vergangenheit weggeschaut.
Auch in Vorarlberg kam es zu Arbeitszeitüberschreitungen. Der Chef der Krankenhausbetriebsgesellschaft, Gerald Fleisch, wurde nach einer Klage des Arbeitsinspektorats nun sogar letztinstanzlich zu einer Geldstrafe von 24.000 Euro verurteilt. Fleisch hat die Sache durchjudiziert, weil er sich selbst als Gefangenen des Systems sah. Sein Argument: Es habe sich die Frage gestellt, ob Arbeitszeiten überschritten oder die Bevölkerung medizinisch schlechter versorgt werden solle.
Als Antwort auf die Kritik der EU folgte dieser Tage eine typisch österreichische Lösung: Die Arbeitszeit wird per Gesetz auf 48 Stunden reduziert, Ärzte dürfen aber innerhalb einer Übergangsfrist „freiwillig“ weiterhin länger arbeiten. Das produziert aber neue Probleme: Arbeiten alle Ärzte künftig um 30 Prozent weniger, fehlt plötzlich ein Drittel der Ärzte. Gleichzeitig müssen die Ärzte mit massiven Gehaltseinbußen rechnen und steigen deshalb auf die Barrikaden, denn bisher waren die Grundgehälter recht niedrig und wurden durch Überstunden- und Nachtzuschläge sowie Zahlungen von Sonderklassepatienten aufgestockt. Das fällt nun teilweise weg. Die Spitalsträger wiederum fürchten, dass zusätzliche Ärzte und höhere Gehälter Mehrkosten von 200 Millionen Euro pro Jahr verursachen werden – Geld, das nicht da ist.
Und ein möglicher Ausweg
Reddy skizziert als möglichen Ausweg die Strukturen, die sie in Frankreich kennengelernt hat. „Keine Hierarchie, der Chef ist der Führende in organisatorischen Angelegenheiten, alle Fachärzte sind gleichwertig und die Assistenten gehen mindestens einmal in der Ausbildung in ein anderes Krankenhaus“, erzählt sie. In der Ausbildung seien alle Assistenzärzte jeden Tag im OP. „Wo soll man denn sonst auch operieren lernen?“ Alltägliche Kleinigkeiten wie Verbandswechsel, Blutabnahmen, EKG schreiben und Infusionen setzen würden vom Pflegepersonal gemacht. Und nicht zuletzt funktioniere die Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen Bereich besser.






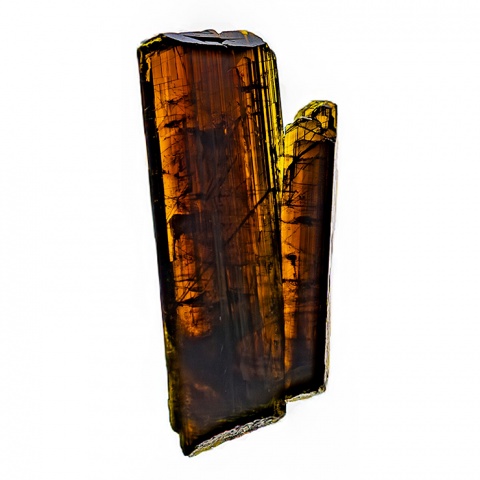






Kommentare