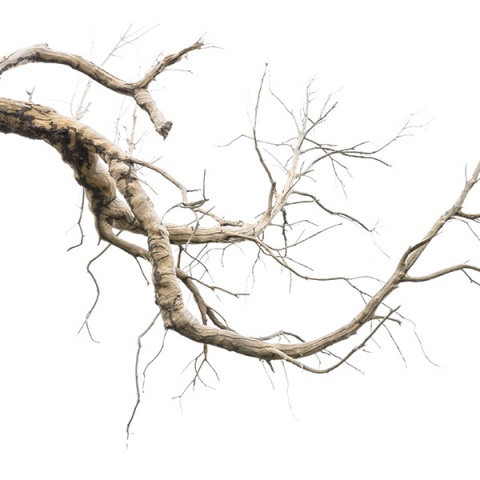
Psychische Erkrankungen Druck auf die Menschen steigt
Die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt massiv zu. Experten rätseln über die Ursachen. Die Folgen hingegen sind eindeutig: persönliches Leid, steigende Krankenstände und massiv steigende Kosten für Psychopharmaka und Frühpensionierungen. Auswege hingegen sind noch rar.
Es ist wohl eines der drängendsten Gesundheitsprobleme. Und wohl eines der am meisten verdrängten – und das betrifft nicht nur das Thema, sondern auch die betroffenen Menschen selbst: Seit Jahren steigt die Zahl psychischer Leiden. Sichtbar wurde es nun wieder einmal bei der Analyse der damit verbundenen Krankenstandstage. Sie sind in den vergangenen 20 Jahren beinahe um das Dreifache gestiegen. In Vorarlberg meldet die Gebietskrankenkasse einen Anstieg von 147.000 Tagen im Jahr 2012 auf zuletzt 182.000 Krankenstandstage – immerhin ein Plus von 24 Prozent.
Das Thema wird meist tabuisiert und die Betroffenen werden ins Abseits gedrängt. Erst wenn man tiefer gräbt, werden die Fakten deutlich – etwa bei den Arzneimittelausgaben: Die Umsätze mit Psychopharmaka sind laut einer Studie der Donau-Universität Krems in Österreich zwischen 2006 und 2013 um 31 Prozent auf 188 Millionen Euro gestiegen. Der Anstieg wurde speziell von Antidepressiva und Antipsychotika verursacht. Zum Vergleich: Die Steigerung bei Psychopharmaka übertrifft die aller anderen pharmazeutischen Produkte deutlich. Diese legten im Vergleichszeitraum um 17,8 Prozent zu. Zahlen, die nicht erstaunen, wenn man bedenkt, dass etwa jeder dritte Österreicher einmal in seinem Leben psychisch erkrankt und aktuell 900.000 Menschen Psychopharmaka einnehmen. Offiziell bekannt ist das bei den wenigsten – auch in den Unternehmen nicht.
Während sich die Pharmabranche über Zuwächse freuen kann, müssen andere Unternehmen mit mehr Ausfällen der Mitarbeiter wegen psychisch bedingter Krankheiten rechnen. Oft ist das Problem aber auch hausgemacht: Immer mehr Beschäftigte beklagen Überlastung und Stress am Arbeitsplatz. „Die Arbeitsbedingungen stehen in einem direkten Zusammenhang mit der individuellen Gesundheit“, hieß es schon 2011 in einer Studie der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung im Auftrag der Arbeiterkammer Wien. Demnach entstehe Stress mit seinen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit in Form beispielsweise von psychischen Erkrankungen dann, wenn eine Arbeitssituation von hohen Anforderungen (wie Zeitdruck oder Hektik), zugleich aber auch von niedrigem Gestaltungsspielraum geprägt sei. Dieser Zusammenhang verstärke sich noch weiter, wenn der soziale Rückhalt am Arbeitsplatz fehle. Geändert hat diese Erkenntnis wenig.
2014 wurde ein Strukturwandelbarometer von der Arbeiterkammer Wien in Auftrag gegeben. 65 Prozent der dort befragten Betriebsräte berichteten über einen Anstieg des Zeitdrucks innerhalb eines Halbjahres, und 60 Prozent sahen einen Zuwachs der Flexibilitätsanforderungen im Unternehmen. Die Evaluierung von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz ist gesetzlich vorgeschrieben, indes: „Bisher erfüllen aber noch viel zu wenige Betriebe diese gesetzlich vorgeschriebene Fürsorgepflicht“, kritisiert Arbeiterkammer-Präsident Rudolf Kaske und sieht die Unternehmen in der Pflicht: „Die Durchführung der Evaluierung psychischer Belastungen ist nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung für die Betriebe, sondern auch eine Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für die Beschäftigten werden gesunde Arbeitsbedingungen geschaffen, für die Unternehmen entstehen weniger Kosten, da die Zahl der Krankenstände sinkt, die Fluktuation abnimmt und die Produktivität zunimmt.“ So wie unselbstständig Beschäftigte generell, leiden übrigens auch Führungskräfte zunehmend unter Stress: Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte hat in seiner Gesundheitsstudie 2015 erhoben, dass Stress 57 Prozent der Manager zusetzt. Bei der Befragung sind unter gesundheitlichen Schwierigkeiten psychische Probleme um fünf Prozent häufiger angegeben worden.
Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der arbeitsbedingten psychischen Belastungen in Österreich belaufen sich auf rund 3,3 Milliarden Euro im Jahr, psychische Probleme von Arbeitnehmern sind der Grund für 3,6 Prozent weniger Wirtschaftsleistung. Die Auswirkungen der psychischen Erkrankung von Arbeitnehmern sind verminderte Produktivität, häufigere und längere Krankenstände, ein früherer Pensionsantritt und häufigere Arbeitslosigkeit. Anders formuliert: Die wirtschaftliche Flaute, die nicht zuletzt Unsicherheit und Stress auslöst, könnte sich ohne die Erkrankungen in ein sattes BIP-Wachstum verwandeln.
Vor allem bei den Invaliditätspensionen sieht man die Steigerung: Gingen 1995 nur zehn Prozent wegen psychischer Erkrankungen in die Invaliditätspension, waren es 2013 bereits ein Drittel. Seit 2014 gibt es für unter 50-Jährige statt dieser Form der Pension das Rehab-Geld. Dieses beträgt 60 Prozent des letzten Bruttoeinkommens und wird höchstens ein Jahr lang bezahlt. Mit dem Rehab-Geld soll versucht werden, zu frühe Pensionierungen zu vermeiden, wenn ein Wiedereinstieg ins Berufsleben möglich ist. Über 18.500 Menschen wurde dieses Geld mit Ende des vergangenen Jahres ausgezahlt, fast drei Viertel der Bezieher erhielten es aufgrund psychischer Erkrankungen. Über 3000 Menschen sind 2015 aus diesem Bezugssystem wieder herausgefallen: Immerhin 41 Prozent der Menschen, die Rehab-Geld bezogen haben, wurden wieder als gesund eingestuft und somit wieder fit für den Arbeitsmarkt. Aber 48 Prozent waren dauerhaft berufsunfähig und mussten in Pension gehen.
Damit Arbeitnehmer wegen psychischer Probleme nicht vorzeitig in der Pension landen, muss man in diesem Bereich ansetzen. Psychopharmaka bieten nicht die einzige Möglichkeit, dagegen zu kämpfen: Eine Studie hat erst kürzlich ergeben, dass eine Psychotherapie genauso wirkungsvoll sein kann wie diese Medikamente. „Viele Patienten mit Depressionen sind auf der Suche nach wirksamen Alternativen zur medikamentösen Behandlung. Unsere Studie zeigt, dass mit der kognitiven Verhaltenstherapie eine gleichermaßen verlässliche, evidenzbasierte Möglichkeit für die Erstbehandlung zur Verfügung steht“, sagt Gerald Gartlehner, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin und Klinische Epidemiologie an der Donau-Universität Krems. Er hat gemeinsam mit US-amerikanischen Kollegen 45 Studien analysiert, die verschiedene Therapieansätze mit modernen Antidepressiva bei schweren Depressionen verglichen haben.
Eine Psychotherapie ist eine Chance auf Heilung ohne Nebenwirkung, die allerdings ihren Preis hat. In Österreich zahlen nicht alle Krankenkassen gleich viel zu einer Psychotherapie dazu. „Die Zuschusshöhe entscheidet für viele Menschen darüber, ob eine Psychotherapie überhaupt leistbar ist“, erklärt Peter Stippl, Präsident des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie. Es gibt zwar Therapieplätze, die zur Gänze von den Sozialversicherungen bezahlt werden, die Wartezeiten dort können allerdings Monate betragen. Wenn man Psychotherapie als private Leistung bezieht, bewegen sich die Honorare in Österreich zwischen 70 und 150 Euro für eine 50-minütige Einzelsitzung.













Kommentare